
Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Die Corona -Pandemie (Covid -19) hat das gesellschaftliche Leben in vielen Teilen der Welt weitestgehend zum Stillstand gebracht. Aus vielerlei Gründen, zu denen u.a. die Globalisierung der Wirtschaft sowie auch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens und die demographischen Veränderungen zählen, ist die Pandemie zur gesellschaftlichen Krise g eworden. Die Menschen in den betroffenen Ländern fordern von den staatlichen Akteuren, diese tiefgreifende Krise so schnell wie möglich und mit Blick auf die Erkrankten so erfolgreich wie möglich zu beenden: Die Kinder wollen wieder in die Schule und rau s auf den Spielplatz, die Menschen wollen wieder arbeiten und ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Für die verantwortlich Handelnden im Krisen management ist das auch deshalb eine extreme Herausforderung, weil niemand voraussagen kann, wie sich diese pa ndemische Lage weiterentwickelt.
In Deutschla nd liegt die Eindämmung des Infektionsgeschehens in der Zuständigkeit der Bundesländer, dort vor allem in den für die Gesundheit zuständigen Ressorts. Nur der Freistaat Bayern hat bisher landesweit den Katastrophenfall erklärt , der na ch Maßgabe des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes eine einheitliche Führung ermöglicht und besondere Strukturen in den Kreisen und kreisfreien Städten aktiviert. Die Befugnisse des Bundes ergeben sich aus dem Infektionsschutzg esetz und sind im Wesentlichen beratender und unterstützender Natur. Fachlich werden diese Aufgaben vom Robert – Koch – Institut wahrgenommen. Weisungsbefugnisse des Bundes gibt es insoweit nicht. Eine solche zentrale Steuerungsbefugnis hat der Bund nur in der größten denkbaren Katastrophe, dem Krieg .
Die Erkenntnis, dass diese föderalen Strukturen und Aufgabenverteilungen einer besonderen Koordinierung und eines regelmäßigen Beübens der Abstimmungsverfahren im Hinblick auf nationale Großschadensereignisse bed ürfen, war bereits Erfahrung der Hochwasserlage an der Elbe im Jahr 2002 , die zwei Jahre später zur Errichtung des Bundsamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) geführt haben. Einer der neuen gesetzlichen Aufträge des BBK war die Durchführung von Übungen auf der strategisch- politischen Ebene zwischen Bund und Ländern, die wir unter dem Namen „LÜKEX“
in der Regel alle zwei Jahre durchführen. Im Jahr 2007 fand eine solche nationale Übung mit einem Influenza -Pandemie- Szenario statt. Seit 2010 fertigt das BBK in Kooperation mit weiteren Partnerbehörden im Auftrag der Bundesregierung jährlich sog. Risikoanalysen an, die dem Deutschen Bundestag über das Bundesinnenministerium vorgelegt werden. Im Jahr 2012 befasst sich diese Analyse mit einem pandemischen Infektionsgeschehen anhand eines angenommenen modifizierten SARS -Virus. Die Notwendigkeit der Befassung mit dieser Thematik beruhte auf einer allgemeinen Risikobewertung, analog der Risikoanalysen aus der Schweiz und Großbritannien, und ist keinesfalls, wie aktuell in sozialen Medien verbreitet wird, ein „Geheimplan der Bundesregierung“. Die Erkenntnisse aus Übung und Risikoanalyse sind in vielfältiger Weise in die Pandemieplanung en eingeflossen, haben das allgemeine Krisenmanagement , die Fähigkeit zur Krisenkommunikation und die Ebenen übergreifende Zusammenarbeit verbessert. Auf der Schattenseite steht demgegenüber, dass sich der eigentliche Auftraggeber für die Risikoanalyse, der Deutsche Bundestag, damit ganz offensichtlich nicht befasst hat und deshalb darau s auch keine Maßnahmen ableiten konnte. Negativ, und in seinen Konsequenzen heute mehr als nur schmerzlich erkennbar, ist , dass d ie festgestellten Defizite, wie z.B. die Bevorratung an Schutzausrüstung en im Gesundheitswesen nicht bereinigt wurde. Das gilt für die Ärzteschaft, die Krankenhäuser genauso wie für Alten- und Pflegeheime, mobile Pflegedienste, den Rettungsdienst oder die Betreiber Kritischer Infrastrukturen und die für das Gesundheitswesen zuständigen Länder behörden. Auf der Bundeseben sind zwar vom BBK bisher an 17 Standorten Sanitätsmateriallager aufgebaut worden Zum einen sind deren Inhalte aber auf Verletzungen und nicht auf Erkrankungen ausgerichtet, zum anderen hatten wir bisher keinen Erfolg bei dem Bemühen, zusätzliche Haushaltsmittel für den weiteren Ausbau auf 100 Standorte zu bekommen.
Erfolgreicher sind wir bei einer anderen uns obliegenden Aufgabenstellung : der Warnung und Information der Bevölkerung. In einer solchen Lage, die geprägt ist von Unsicherheit und Ängsten, weil das Virus nicht sichtbar oder unmittelbar fühlbar ist, und weil es – gerade vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der so genannt en Sozialen Medien – eine widersprüchliche und zum Teil bewusst falsche Berichterstattung in diesen Medien gibt, ist es notwend ig, die Entscheidungsfindungen transparent zu machen. Dies bedeutet, eine speziell auf Zielgruppen zugeschnittenen Informationspo litik zu betreiben, unabhängige wissenschaftliche Gremien einzubeziehen und d ie Ergebnisse dann über zentrale, gebündelte Kommunikationsinstanzen und – wege zu transportieren. Das BBK betreibt seit Jahren das Modulare Warnsystem mit der Warn-App NINA ( Notfall- Informations – und Nachrichten- App). Bisher haben fast 7 Millionen Nutzer diese App heruntergeladen. In der aktuellen Lage wird sie intensiv von Bund, Ländern sowie Städten und Landkreisen für die Aussendung von Handlungsempfehlungen oder – anweisungen genutzt. Nun hat der Deutsche Bundestag kurzfristig Haushaltsmittel für den Ausbau des Systems auf 40 Millionen Nutzer bereitgestellt. Die technische Umsetzung soll noch bis Ende April erfolgen.
Das BBK nutzt diese App, um dort auch eigen Empfehlungen zum Umgang mit oder zum Verhalten in der Pandemie einzustellen. Diese finden sich aber auch auf der Homepage oder sind als Print -Produkte abrufbar . Dazu gehören zum einen zahlreiche Handlungsempfehlungen für Bürgerinnen und Bürger zum Selbstschutz und zur Sel bsthilfe, Ratgeber für Behörden sowie für die Betreiber Kritischer Infrastrukturen (z. B. „ Handbuch betriebliche Pandemieplanung “), zum anderen aber auch sehr spezielle Tipps und Hilfestellungen für die Menschen in dieser besonderen aktuellen Situation ( „Tipps bei häuslicher Quarantäne “). Zu weiteren Angeboten, Produkten oder auch Fragen an das BBK haben wir auf unserer Homepage ( www.bbk.bund.de ) eine FAQ-Liste eingestellt.
Quelle:
Christoph Unger
Präsident Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Der Artikel stammt aus dem Newsletter Ak Sicherheit und Bundeswehr der NRW SPD (Ausgabe 01/2020).


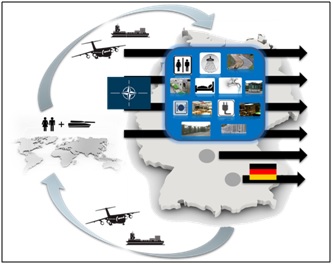




 Während der Veranstaltung wurden im Namen des Präsidenten 2 Mitglieder aus der Gründungszeit der Kameradschaft für 25 Jahre Mitgliedschaft im „blauen Bund e.V.“ mit silberner Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet: Oberstleutnant d.R. Reinhold Kölle und Stabshauptmann a.D. Wolfgang Proksch (s. Foto).
Während der Veranstaltung wurden im Namen des Präsidenten 2 Mitglieder aus der Gründungszeit der Kameradschaft für 25 Jahre Mitgliedschaft im „blauen Bund e.V.“ mit silberner Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet: Oberstleutnant d.R. Reinhold Kölle und Stabshauptmann a.D. Wolfgang Proksch (s. Foto).

