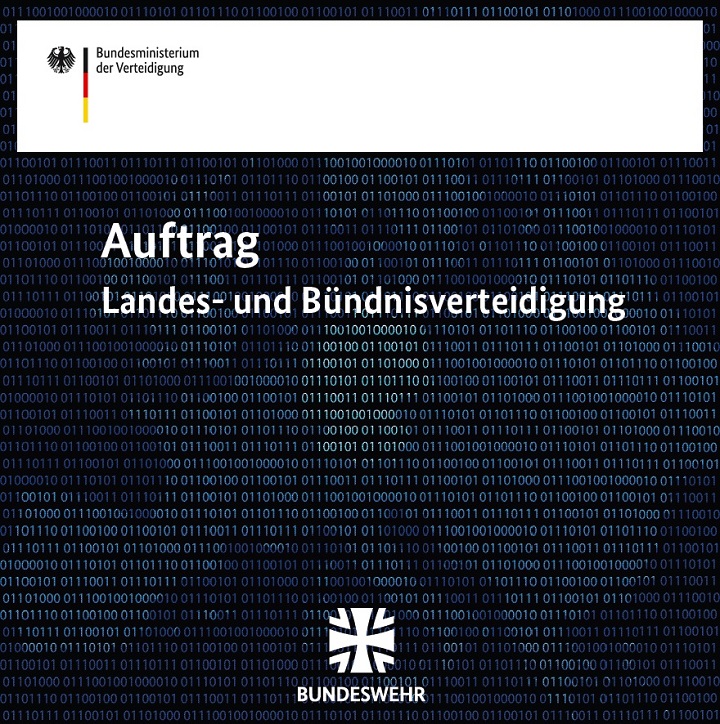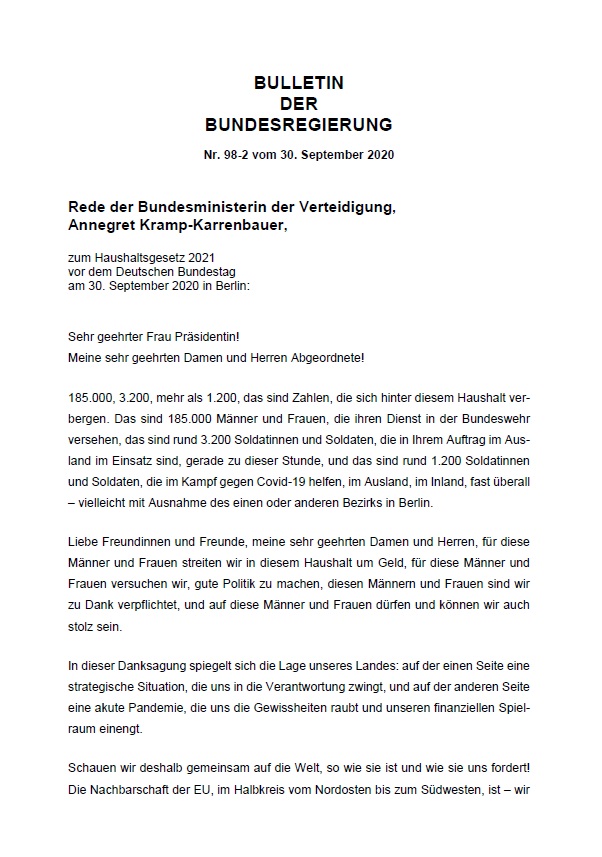Sehr geehrter Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete!
185.000, 3.200, mehr als 1.200, das sind Zahlen, die sich hinter diesem Haushalt verbergen. Das sind 185.000 Männer und Frauen, die ihren Dienst in der Bundeswehr versehen, das sind rund 3.200 Soldatinnen und Soldaten, die in Ihrem Auftrag im Ausland im Einsatz sind, gerade zu dieser Stunde, und das sind rund 1.200 Soldatinnen und Soldaten, die im Kampf gegen Covid-19 helfen, im Ausland, im Inland, fast überall – vielleicht mit Ausnahme des einen oder anderen Bezirks in Berlin.
Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, für diese Männer und Frauen streiten wir in diesem Haushalt um Geld, für diese Männer und Frauen versuchen wir, gute Politik zu machen, diesen Männern und Frauen sind wir zu Dank verpflichtet, und auf diese Männer und Frauen dürfen und können wir auch stolz sein.
In dieser Danksagung spiegelt sich die Lage unseres Landes: auf der einen Seite eine strategische Situation, die uns in die Verantwortung zwingt, und auf der anderen Seite eine akute Pandemie, die uns die Gewissheiten raubt und unseren finanziellen Spielraum einengt.
Schauen wir deshalb gemeinsam auf die Welt, so wie sie ist und wie sie uns fordert! Die Nachbarschaft der EU, im Halbkreis vom Nordosten bis zum Südwesten, ist – wir haben das eben in der Debatte schon gehört – krisenbeladen und instabil, von Misstrauen und leider oft genug auch von Gewalt geprägt. Doch es ist unsere Nachbar- schaft, mit Menschen, die uns am Herzen liegen, mit wirtschaftlichen, politischen und humanitären Interessen. Ein Blick auf die Karte und in ebendiese Nachbarschaft genügt, um deutlich zu machen: Sicherheit in Europa ist nicht teilbar, die Sicherheit der Länder um uns herum ist auch unsere Sicherheit.
Das ist einer der Gründe, warum die Bündnis- und Landesverteidigung in unseren Planungen heute wieder eine zentrale Rolle spielt; der Generalinspekteur der Bundeswehr hat das heute in einem Beitrag entsprechend belegt. Deshalb nutzen wir die deutsche Ratspräsidentschaft auch, um erstmals in der europäischen Geschichte eine gemeinsame Bedrohungsanalyse aller 27 Mitgliedstaaten und für alle 27 Mitgliedstaaten zu erstellen. Zu dieser Bedrohungsanalyse gehört ganz sicher auch die Tatsache, dass in der digitalisierten Welt die Sicherheit unserer Daten, unserer Netzwerke, unserer lebenswichtigen Infrastruktur auf dem Spiel steht und auch der Weltraum als Domäne längst kritische Relevanz hat.
Schließlich fällt der Blick auch nach Asien, auf China und auf die Auswirkungen, die eine veränderte Machtbalance dort auf uns, auch hier in Europa und in Deutschland, hat. Die neuen Leitlinien der Bundesregierung zum Indopazifik definieren Deutschlands Rolle in dieser entscheidenden Weltregion, in der ein großer Teil unseres Wohlstandes erwirtschaftet wird. Um es noch einmal deutlich zu machen, weil es heute Morgen wohl die eine oder andere Unsicherheit über die Rolle der Bundesregierung und auch die Rolle der Bundeswehr in diesem Raum gab, darf ich zitieren aus ebendiesen Leitlinien zum Indopazifik:
Die Bundesregierung wird ihr sicherheitspolitisches Engagement im Indopazifik ausweiten die sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperation in der Region mit ihren Partnern ausbauen. Dies kann die Teilnahme – unter anderem – an Übungen in der Region sowie verschiedene Formen maritimer Präsenz umfassen. Für die, die es nicht wissen: „Maritime Präsenz“ ist die Übersetzung von „Schiff“. Deswegen werden wir, wenn Covid es erlaubt, nächstes Jahr mit der Bundeswehr auch in diesem Raum präsent sein.
Dieser Blick macht deutlich: Wenn unser Geschäftsmodell global ist, dann muss auch unsere Sicherheitspolitik global sein. Ich muss deshalb noch einmal deutlich sagen: Wir Deutsche werden als Sicherheitsgarant dafür mehr tun müssen – nicht für Trump, nicht für irgendwen, sondern für unsere eigene Sicherheit.
Lassen Sie mich mit Blick auf das, was die Linken heute Morgen in der Generaldebatte gesagt haben – ich meine den platten Versuch, Bildung gegen Sicherheit und gegen Verteidigung auszuspielen –, noch einmal deutlich sagen: Ich will gut-, ja bestausgebildete Kinder in der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich will, dass sie zu selbstbestimmten Menschen heranwachsen können, die in Frieden und Freiheit leben. Und für Frieden und Freiheit stehen die Bundeswehr, die gemeinsame europäische Verteidigung und die Nato. Dafür lohnt es sich, Geld in die Hand zu nehmen.
Es ist unsere Aufgabe, diesen Anspruch mit Leben zu erfüllen in einer Zeit, in der die Mittel nicht in den Himmel wachsen. Der Finanzminister hat gestern gesagt, Haushalt und Planungen stehen unter besonderen Bedingungen. Mit dem Haushalt 2021 steigen unsere Verteidigungsausgaben noch einmal. Das ist ein wichtiger Erfolg, und dafür bin ich dankbar.
Bei einigen der langfristigen Rüstungsprojekte hat die Pandemie die Lage aber verändert; hier fordern die Hersteller, die durch Corona in Not geraten sind, größere Teile der Kosten zu einem früheren Zeitpunkt ein. Das heißt, die Gesamtkosten steigen nicht, aber die Bugwelle erreicht uns früher, und dadurch werden Planungen obsolet. Konkret heißt das: Die großen Beschaffungsvorhaben, allen voran europäische Kooperationsvorhaben, werden nur umsetzbar sein, wenn dafür in Zukunft zusätzliches Geld bereitgestellt wird. Das gilt für den Eurofighter wie für das deutsch-französische FCAS-Projekt und den Hubschrauber NH90. Wenn deutsche und europäische Unternehmen die Liquidität erhalten sollen, die sie brauchen, dann müssen dafür neue Zusagen gemacht werden. Das ist ein Anliegen der gesamten Bundesregierung.
Der Finanzminister hat gestern auch gesagt: Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Investitionstätigkeit in diesem Jahr und in den folgenden Jahren nicht zurückgeht. Er hat recht; denn es geht bei unserem Etat nicht nur um Sicherheit, es geht auch um Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland. Bei all dem ist besonders wichtig: Diese Großvorhaben werden nicht bedingungslos umgesetzt, und sie werden schon gar nicht zulasten kleiner und mittlerer Projekte umgesetzt, die wir für das Funktionieren des Gesamtsystems Bundeswehr brauchen. Das haben wir in der Vergangenheit zu lange getan, und an dem Ergebnis leidet die Bundeswehr, leiden die Soldatinnen und Soldaten noch heute.
Mein Lieblingsbeispiel dazu: Seit fast 20 Jahren beabsichtigt die Bundeswehr, einen speziellen Pionierwerkzeugsatz zu beschaffen, und seit 20 Jahren ist er immer wieder herunterpriorisiert worden, weil das Geld nicht gereicht hat. Das führt zu Verdruss, das führt zu Verärgerung, und zwar vollkommen zu Recht, und damit muss Schluss sein.
Worauf kommt es also im Jahr 2021 an? Es kommt darauf an, unsere Soldatinnen und Soldaten mit Material auszustatten – ein dickes Brett, ich weiß. Die Initiative Einsatzbereitschaft, die wir im Februar gestartet haben, bei der wir bis zum Juni über 90 Prozent der identifizierten Vorhaben angepackt haben, wird auch weiter ein dickes Brett bleiben, auch wenn wir erste Fortschritte sehen: Flugstunden für den Eurofighter und andere Luftfahrzeuge der Luftwaffe sind erhöht worden. Über 1.200 moderne Lkws sind in der Truppe angekommen, lösen die teils 40 Jahre alten Vorgänger ab, weitere müssen folgen. Kurzfristig sind die Kapazitäten bei der bundeswehreigenen Instandsetzung aufgestockt worden.
Aber das reicht noch nicht aus. Es muss Weiteres dazukommen. Dazu gehört als ein zentrales Vorhaben auch die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Für den bestmöglichen Schutz unserer Streitkräfte im Einsatz ist das unerlässlich.
Das Verteidigungsministerium hat hier im Juli, so wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen war, die Ergebnisse einer intensiven Anhörung vorgestellt und Einsatzgrundsätze dafür entsprechend vorgelegt. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche zu einer abschließenden Beschlussfassung beim Koalitionspartner kommen, dass wir grünes Licht vom Parlament erhalten, um dann sofort in die Verhandlungen einzusteigen, um schnellstmöglich die 25-Millionen-Euro-Vorlage ins Parlament einzubringen.
Dabei ist wichtig, dass wir von der Industrie auch wirklich als ein Premiumkunde behandelt werden. Wir zeigen gerade auch beim Projekt „schwerer Transporthubschrauber“, dass wir nicht alles und nicht zu jedem Preis abnehmen, was uns angeboten wird. Auch das sind wir der Bundeswehr, das sind wir aber auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dieses Landes schuldig.
Bei der Heeresinstandsetzungslogistik, die wir gemäß Beschluss des vergangenen Jahres nicht mehr privatisieren werden, sind wir in der Lage, in den nächsten Wochen die entsprechende neue Eigentümerstrategie vorzulegen, um auf dieser Grundlage dann auch in die weiteren Planungen für die Werke einzutreten.
Der vormalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, hat gestern Abend bei seiner Verabschiedung sehr treffend Folgendes gesagt: Die Bundeswehr ist eine Armee der Demokraten in der Demokratie für die Demokratie. – Die allermeisten Soldatinnen und Soldaten sind in die Bundeswehr eingetreten, um für diese Demokratie einzutreten. Diese Soldatinnen und Soldaten bekommen meine, bekommen unsere Rückendeckung. Wir lassen es nicht zu, dass der Dienst dieser Soldatinnen und Soldaten von einer verfassungsfeindlichen Minderheit entwertet und verraten wird. Dafür arbeiten wir alle gemeinsam.
Und wir arbeiten daran, dass die Bundeswehr vielfältig ist, dass nicht danach gefragt wird, welche Hautfarbe ein Soldat oder eine Soldatin hat, welches Geschlecht, wel- che sexuelle Präferenz, welchen Glauben, woher er kommt, sondern dass wir sagen: Es kommt darauf an, was dieser Soldat beziehungsweise diese Soldatin leisten. Deswegen bin ich froh, dass wir feststellen konnten: Die vorvergangene Praxis der Diskriminierung von Homosexuellen in der Bundeswehr war falsch. Dafür haben wir uns entschuldigt. Jetzt geht es um die Entschädigung. Und ich hoffe, dass wir noch in dieser Legislaturperiode mit Ihrer aller Unterstützung in diesem Haus ein entsprechendes Gesetz verabschieden können.
Vor 30 Jahren, als das vereinte Deutschland zusammenwachsen musste, durfte, zum Glück durfte, war die Bundeswehr, was viele gar nicht erwartet haben, ein Motor der Integration von Ost und West. Heute, 30 Jahre nach der Einheit, gilt, dass Deutschland sicherheitspolitisch in eine neue Rolle hineinwachsen muss. Und wieder kann die Bundeswehr ein Motor sein, der einen wichtigen politischen und gesellschaftlichen Prozess voranbringt, indem unsere Streitkräfte Deutschland, seine Menschen, seine Interessen, seine Werte verteidigen und indem wir dafür unsere Verantwortung stärken, in Europa und in der Welt.
Herzlichen Dank.
Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung