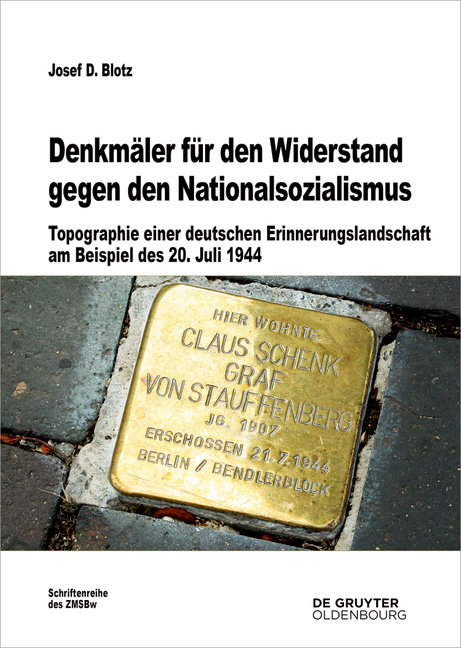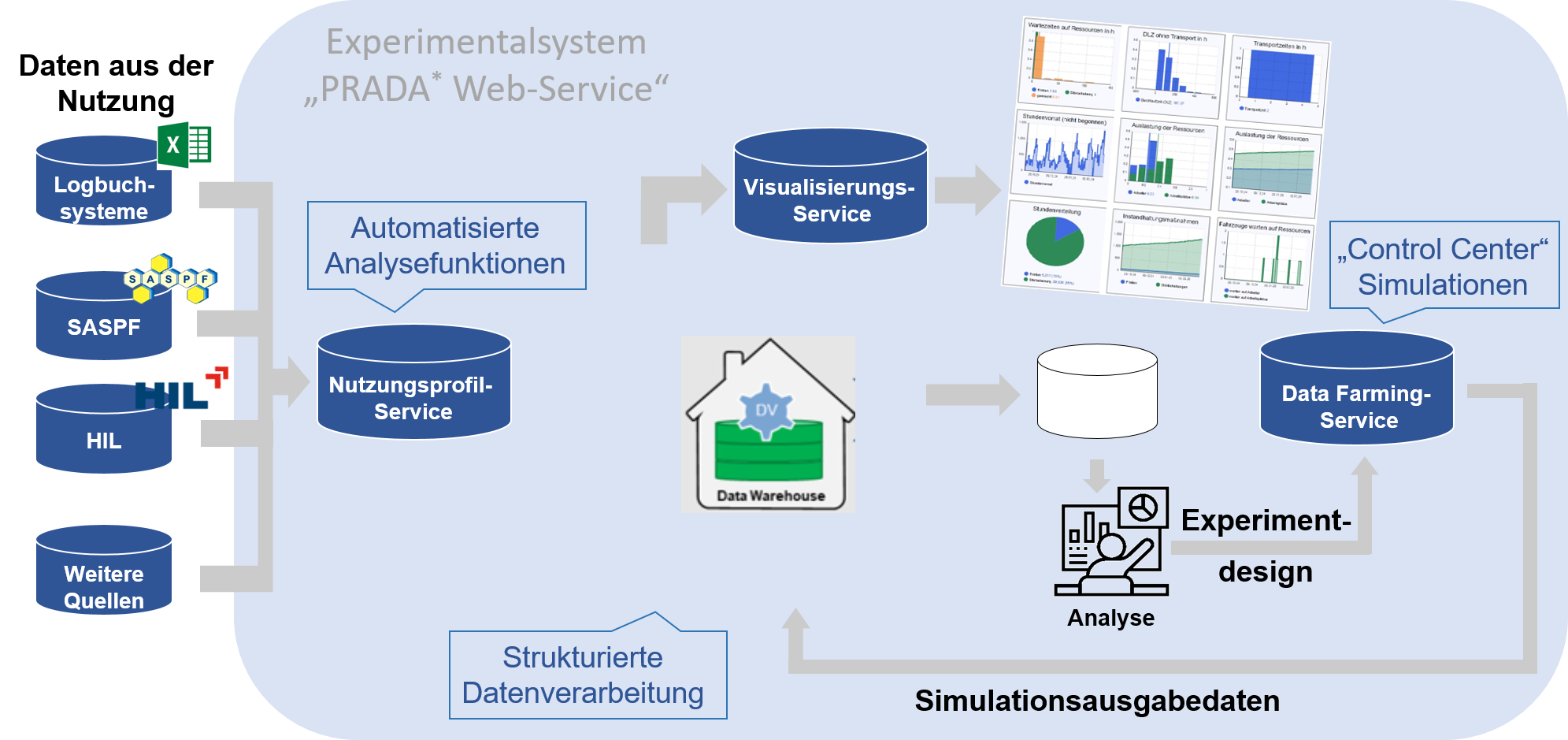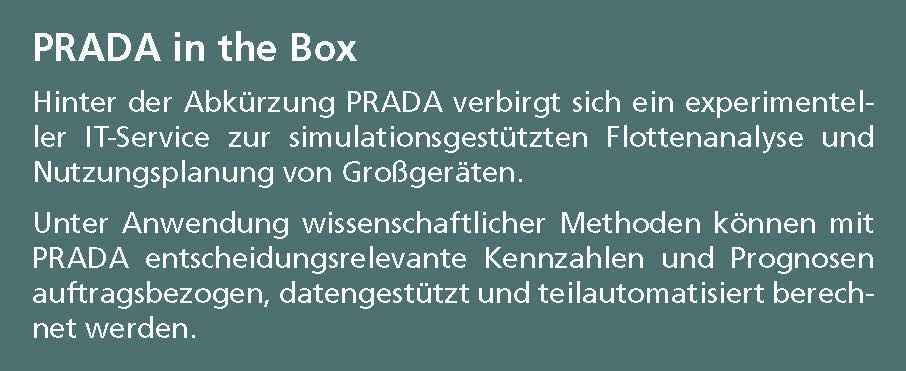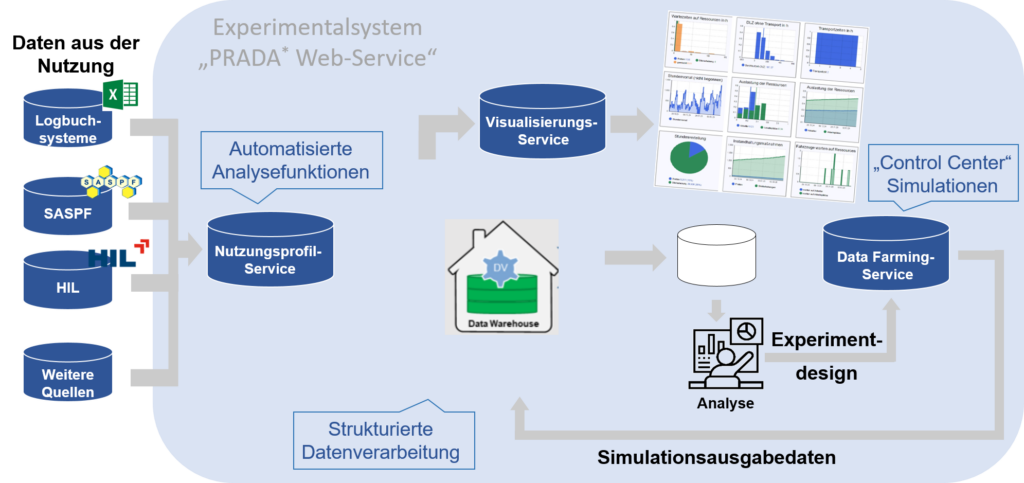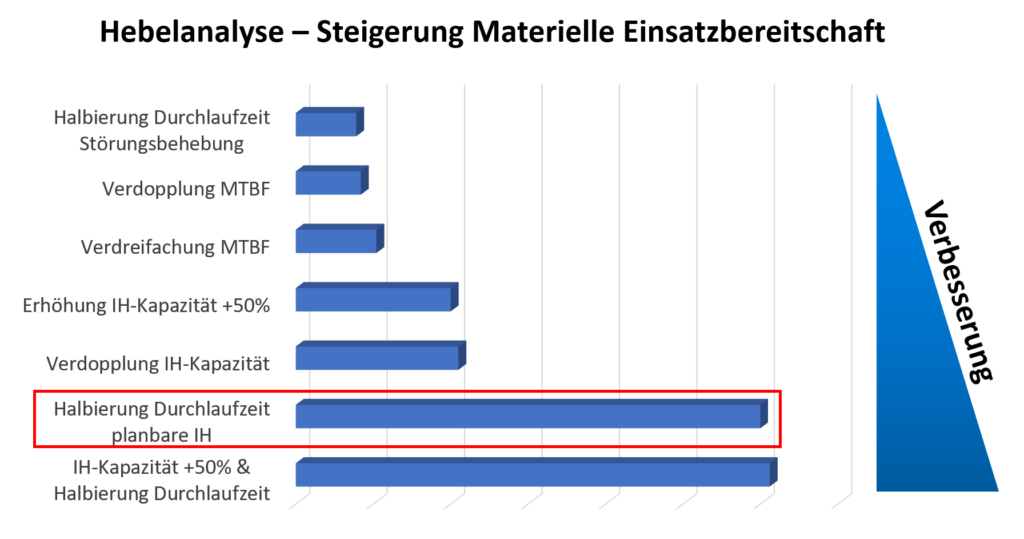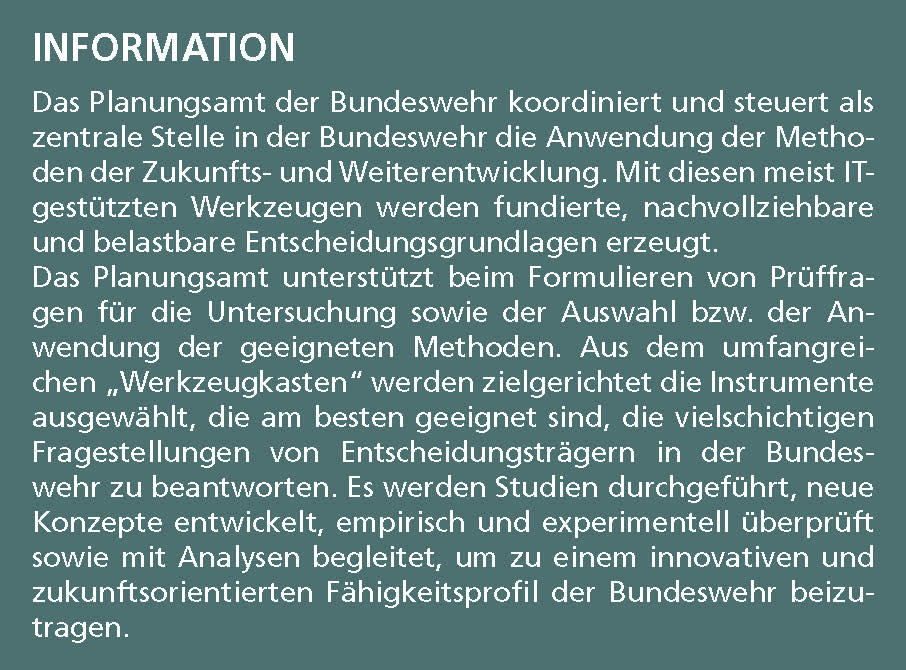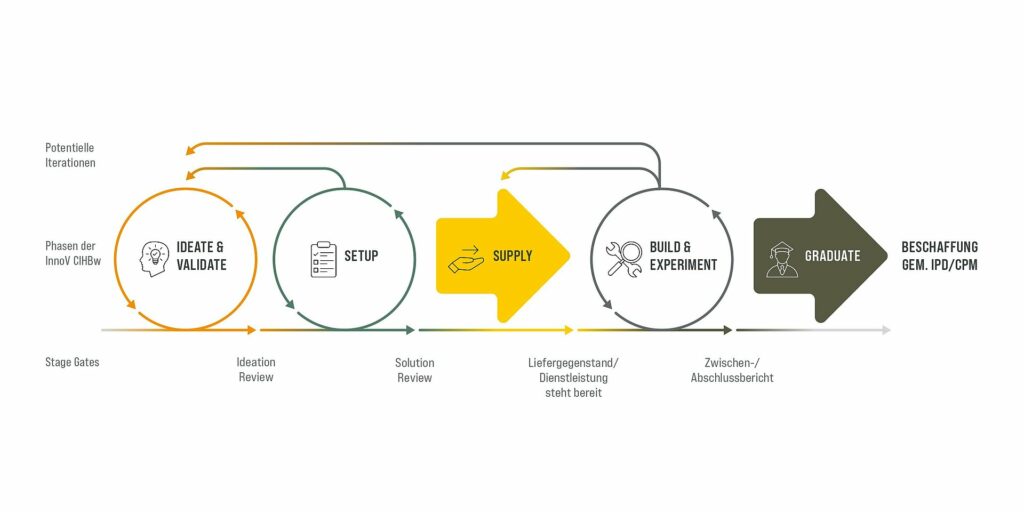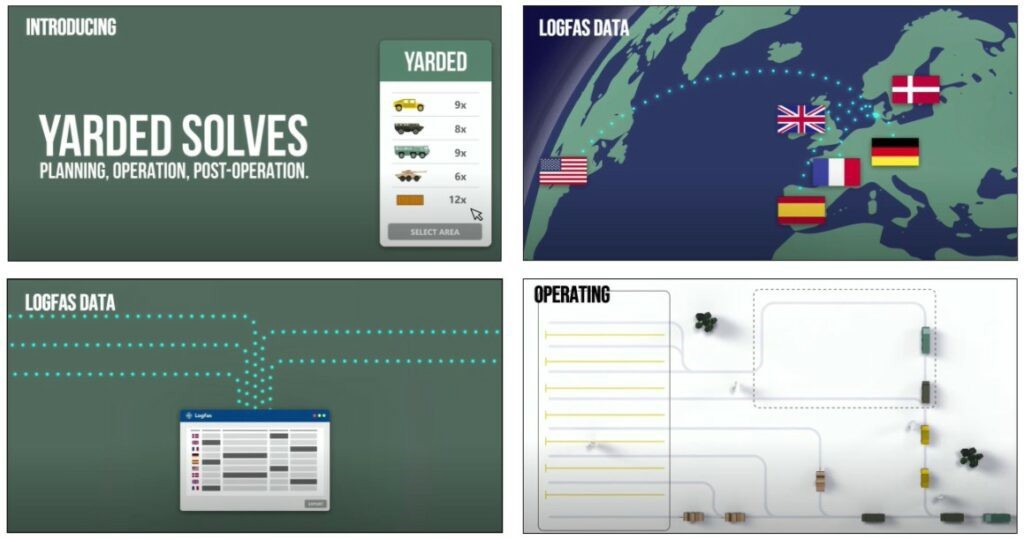Die „Zeitenwende“ findet auch bei unserem größten Nachbarn statt, die französischen Landstreitkräfte werden konsequent auf ihre Aufgaben im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet. Hieran hat auch das Deutsche Heer unmittelbaren Anteil – einige deutsche Offiziere besetzen Schlüsselpositionen im Rapid Reaction Corps France in LILLE.

Das Rapid Reaction Corps France (RRC-FRA) ist, ebenso wie das französische Heeresführungskommando (C.F.O.T.), im äußersten Norden des Landes, unweit der belgischen Grenze beheimatet. Die Indienststellung in 2005 erfolgte zwar um einige Jahre später als die vergleichbarer Korpsstäbe in anderen europäischen Staaten, ging aber der französischen Rückkehr in die integrierte Kommandostruktur der NATO noch um vier Jahre voraus. Nicht nur in zeitlicher Hinsicht fungiert das RRC-FRA somit und bis heute als Bindeglied zwischen der NATO und den französischen Streitkräften: Es ist die höchste verlegefähige Kommandobehörde der französischen Armee, in dieser Rolle federführend in der Beübung der beiden Heeresdivisionen sowie maßgeblich beteiligt an der Umstrukturierung der französischen Landstreitkräfte hin zu einer „Armee der fünften Dimension“ und „Start-Up Army“, wie es der französische Inspekteur des Heeres, General Pierre Schill, im Dezember 2023 betonte. Zugleich reiht es sich ein in die NATO-Streitkräftestruktur (kurz: NFS, engl. NATO Force Structure) als einer von insgesamt zehn verlegefähigen Korps-Stäben, die generisch neuerdings als „NATO Response Corps (NRC)“ bezeichnet werden. Die nun knapp zwanzigjährige Geschichte des Korps ist gekennzeichnet von der Bewährung in häufig wechselnden Rollen. So erfolgte zunächst die Zertifizierung zur High Readiness Force 2007, sodann zum Land Component Command (LCC) der NATO Response Force 2008, 2014 und 2022 – jeweils gefolgt von Phasen erhöhter Bereitschaft; ferner die Entsendung von Personal zu Stabilisierungsoperationen nach Afghanistan (ISAF/RSM) und als European Forces in den Tschad sowie die Zentralafrikanische Republik. Darüber hinaus werden seit 2015 kontinuierlich aus dem Stab heraus Kräfte zu den inländischen Antiterror-Operationen „Vigipirate“ bzw. „Sentinelle“ abgestellt. Im März 2024 wurde die Zertifizierung als NATO Warfighting Corps im Zuge der Übung LOYAL LEDA 24 abgeschlossen. Das Korps ist befähigt, bis zu fünf Divisionen und Korpstruppen, insgesamt rund 100.000 Soldaten, in einem Konflikt mit hoher Intensität zu führen. In die aktuellen Verteidigungsplanungen der NATO ist das RRC-FRA eng eingebunden. Es ist zu erwarten, dass die Rolle des Korps anlässlich des Washingtoner Jubiläumsgipfels der Allianz im Juli 2024 bestätigt werden wird. Bis auf weiteres soll es sodann bei dieser zugewiesenen Rolle bleiben, die erforderlichen Fähigkeiten werden durch geeignete Ausbildungs- und Übungsprogramme auch über Personalwechsel hinweg aufrechterhalten.

© CRR-FR / Amaury Duthoy
Die insgesamt rund 430 Soldaten stammen aus 14 Nationen, mit Frankreich als Gastgeber- und einziger Rahmennation. Die Nachbarländer Deutschland und Belgien stellen die nächstgrößeren Kontingente und besetzen Schlüsselpositionen. So ist der Stellvertreter des Kommandierenden Generals (Deputy Commander, DCOM) seit 2005 durchgehend ein deutscher Generalmajor, zudem dienen deutsche Offiziere in den Abteilungen G7 und G5 an besonders hervorgehobener Stelle. In den Abteilungen G2, G35, G4, G6 und Feuerunterstützung (JFIT) nehmen weitere deutsche Offiziere maßgeblichen Einfluss vor allem auf die Planungsarbeit. Insgesamt dienen beim RRC-FRA 14 deutsche Heeressoldaten, davon zwei in einem nationalen Unterstützunsgelement. Die vereinbarte Arbeitssprache ist Englisch, die Stabsverfahren orientieren sich an den Vorgaben der NATO – soweit jedenfalls die Theorie. Tatsächlich kann jedoch mit Blick auf die nationalen Anteile des Aufgabenspektrums weder in Gänze auf die Nutzung der französischen Sprache verzichtet werden noch auf die Kenntnis und fallweise Anwendung der nationalen Militärdoktrin. Diese teils widerstreitenden Belange immer wieder in einen sinnfälligen Ausgleich zu bringen, macht u.a. für das entsandte deutsche Personal die Herausforderung, nicht zuletzt aber auch den Reiz einer Verwendung beim RRC-FRA aus.

Die Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung als Raison d’être des Militärs wurde besonders deutlich im Zuge der letztjährigen, vierteiligen Übungsserie ORION 23 demonstriert. Unter Beteiligung zahlreicher NATO-Partner, darüber hinaus aber auch beispielsweise indischer Truppenteile, wurde über Monate hinweg die Intensivierung konventioneller wie auch hybrider Bedrohungen geschildert, denen durch abgestufte, sich ebenfalls steigernde Gegenmaßnahmen letztlich erfolgreich begegnet wurde. Nicht zuletzt durch die enthaltenen Volltruppenanteile handelte es sich bei ORION 23 um ein Übungsvorhaben, das in Frankreich, aber auch in weiteren Teilen Europas ohne Beispiel seit 1987 war, also seit der Spätphase des Kalten Krieges. Das Rapid Reaction Corps France spielte eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung und ebenfalls in der Durchführungsphase – mit Teilen im Leitungsdienst, aber auch als Teil der Übungstruppe. Das erfolgreiche Großprojekt soll in 2026 eine Wiederholung erfahren, und erneut ist RRC-FRA im vorgenannten Umfang beauftragt worden. Bis dahin liegen die Arbeits- und Übungsbeziehungen zwischen RRC-FRA und den Truppenteilen und Dienststellen des französischen Heeres jedoch keineswegs brach. Vielmehr wird der Übungskalender mit Blick v.a. auf die beiden Heeresdivisionen deutlich verdichtet. Für diese beiden Großverbände ist ein alternierender Rollenwechsel im Rhythmus von jeweils drei Jahren vorgesehen, zwischen dem Verantwortungsbereich „Europa“ und „übrige Welt“. Ersteres zielt v.a. auf den Beitrag Frankreichs zur atlantischen Allianz, letzteres vorrangig auf überseeische französische Territorien sowie die Region Afrika / Naher Osten. Hierdurch ergeben sich für die Soldaten des Deutschen Anteils einmalige Einblicke sowohl hinsichtlich der französischen Positionierung und Mitwirkung im Bündnis wie auch bezüglich der nationalen Interessenverfolgung in aller Welt.

Abschließend noch einmal ein Blick auf LILLE, die Heimat des RRC-FRA. Die Stadt, Herzstück des viertgrößten französischen Ballungsraumes und zugleich auch einer grenzüberschreitenden europäischen Metropolregion, hat den Soldaten und deren Familien viel zu bieten. Viel Grün, zahlreiche Gewässer, sehenswerte historische Bausubstanz und ein ausgefeiltes Nahverkehrssystem, zudem meist kurze Wege – viel mehr kann man von seiner Garnison kaum erwarten. Sollte man dennoch einmal auf Reisen gehen wollen oder müssen, so profitiert man vor allem von der exzellenten Anbindung auf dem Schienenweg: Eine Stunde Fahrzeit nach Paris, eine halbe nach Brüssel oder ca. 80 Minuten nach London – auch in dieser Hinsicht wird man es schwerlich besser treffen können. Ein weiteres Highlight dieser Attraktivitätsfaktoren stellt das von RRC-FRA genutzte Stabsquartier dar – die in unmittelbarer Innenstadtnähe gelegene Zitadelle von LILLE. Zwischen 1668 und 1671 wurde sie nach den Plänen des Marschalls Sébastien Le Prestre de Vauban gebaut, eben jenes Großmeisters der Ingenieurskunst, der für den Bau und die Modernisierung von über 100 weiteren Festungen und Verteidigungsanlagen verantwortlich war. Ludwig XIV. hatte den Bau dieses gewaltigen Verteidigungsrings an den damals neuen Grenzen Frankreichs veranlasst, nachdem er diese Gebiete im Frieden von Aachen zulasten der spanischen Niederlande zugesprochen bekommen hatte. Ungeachtet aller zwischenzeitlichen historischen Wechselfälle hat diese Grenzziehung bis heute im Wesentlichen Bestand.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Dienst im RRC-FRA von den Soldaten des Deutschen Anteils als gleichermaßen sinnstiftend wie attraktiv empfunden wird. LILLE ist nicht nur eine Reise wert – wer darüber hinaus als geeignet für eine hiesige Verwendung identifiziert wird und eine solche angeboten bekommt, sollte zugreifen!
Text: Hauptmann Simon Baaske